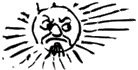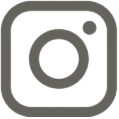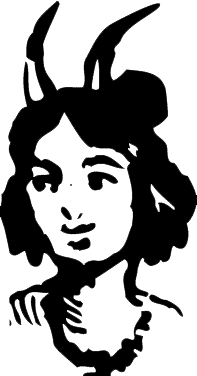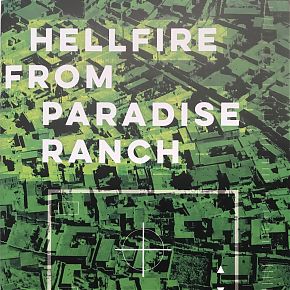Die Flöße der Medusa
Wie die libysche Küstenwache am tödlichen Schmuggel mit Flüchtlingen verdient
Juni 2023
Or read it in English

Fotos von Maria Giulia Trombini
DAS ERSTE BOOT, das wir fanden, war nichts als eine Aluminiumhülle, die schief im dämmerungsblauen Wasser trieb. Die Sonne ging gerade unter, und wir warfen uns in Overalls und Rettungswesten, um Menschen zu bergen, aber der Kapitän blies die Sache ab. Das Boot war leer und trieb im Licht der Scheinwerfer vorbei. “Es hat keinen Motor”, sagte Viviana, eine liebenswürdige Sizilianerin, seit mehreren Jahren in der zivilen Seenotrettung aktiv. In der Nähe Libyens sei es normal, Boote ohne Motor anzutreffen, weil die libysche Küstenwache die Motoren für die Wiederverwendung beschlagnahme. Das ergab auf den ersten Blick keinen Sinn. Doch dann begriff ich den Grund.
“Es ist auch nicht markiert”, sagte sie. Retten NGOs Menschen von einem Boot, das nördlich von Libyen oder Tunesien treibt, markieren sie es mit Sprühfarbe, um so den Überblick zu behalten. Die Libyer tun das nicht. “Wir haben es hier also vermutlich mit einer Abfangaktion der sogenannten libyschen Küstenwache zu tun.”
Unser Schiff, die Humanity 1, gehört SOS Humanity, einer zivilen Seenotrettungsorganisation aus Berlin. Ich war bei dieser Fahrt als Journalist an Bord. Ich hatte schon früher über die Routen der Menschenschmuggler geschrieben. Als ich 2016 die Bundesmarine bei Rettungsaktionen begleitete, machte die Besatzung die Boote der Schmuggler noch seeuntauglich. Ich erinnere mich an ein Gummifloß, das wie eine Ölpfütze auf dem Wasser brannte – auf diese Weise wollte man verhindern, dass libysche Banden es erneut verwenden.
“Warum sollte die Küstenwache die Motoren kassieren?”, fragte ich unseren Kapitän Josh Wedler. “Warum zerstören sie nicht einfach die Ausrüstung der Schleuser?”
Josh lächelte. Der kräftige, tätowierte Deutsche mit dunklen Haaren und Tunneln im Ohr mochte wie ein Pirat aussehen und auf der Brücke den Punk spielen, aber er legte großen Wert auf Disziplin.
“Deshalb müssen wir ‘sogenannte libysche Küstenwache’ sagen”, erklärte er mir. “Wer als ‘Küstenwache’ unterwegs ist, arbeitet entweder direkt mit den Leuten zusammen, die diese Boote zu Wasser lassen, oder er steht über den Schwarzmarkt mit ihnen in Kontakt. Manchmal wollen sie diese billigen Boote aus Holz oder Gummi erneut verwenden – und natürlich die Motoren. Einige Motoren sind nagelneu.”
§
Das zweite Boot war aus Glasfaser und war abgefackelt worden. Morgens hatten wir in einiger Entfernung zwei libysche Schiffe gesehen, die rasch Richtung Süden unterwegs waren. Wir dachten, sie wollten bloß zeigen, dass sie innerhalb ihres Patrouillengebiets das Sagen hatten, aber um neun Uhr begann am Horizont brauner Rauch aufzusteigen.
“Das ist ein brennendes Boot”, sagte Welly, der Schiffsarzt, der gerade Wache schob.
“Wer hat es angezündet?”
“Keine Ahnung.”
Ein Beobachtungsflugzeug der Seenotretter überflog uns, um sich das Feuer anzusehen. Die warme Jahreszeit hatte begonnen, und der April 2023 brach alle Migrationsrekorde seit 2017. Viermal so viele Menschen waren auf dem Meer unterwegs wie im gleichen Monat des Vorjahres. Einer der Gründe war der eskalierende Rassismus in Libyens Nachbarland Tunesien, wo Präsident Kais Saied Hasstiraden gegen Afrikaner aus der Subsahara-Region verbreitet hatte. Die folgende Gewaltwelle trieb viele Migranten in die Boote.
Das Glasfaserboot war in der Nähe der westlichen Küste Libyens entdeckt worden, und ein Beobachtungsflugzeug meldete Flüchtlinge an Bord eines Schiffs, der Zawiyah. Es handelte sich also um eine weitere Abfangaktion der Küstenwache. Sie hatte sich so beeilt, weil sie die Flüchtlinge einsammeln wollte, bevor sie die libyschen Hoheitsgewässer verließen. Vermutlich hatten sie auch den Motor an sich genommen und das Boot in Brand gesetzt. Als wir es einige Stunden später in internationalen Gewässern fanden, war der Rumpf geschmolzen.
Libyens Küstenwache ist berüchtigt für oft skrupellose Manöver, um Migranten abzufangen. Mit den Schiffen europäischer Seenothelfer befinden sie sich in einem Konkurrenzkampf, auch befeuert durch die lukrativen Verträge mit der EU und einzelnen Mitgliedsstaaten zur “Migrationskontrolle”. Jeder abgefangene Flüchtling rechtfertigt die Gelder aus Brüssel. Aber die Küstenwache ist längst auch rechtswidrig außerhalb ihrer Hoheitszone von 24 Seemeilen im Einsatz. Als im März dieses Jahres das NGO-Schiff Ocean Viking fast 70 Kilometer vor der Küste Geflüchtete von einem voll besetzten Schlauchboot bergen wollte, kam eine Patrouille der libyschen Küstenwache gefährlich nahe und feuerte Warnschüsse auf NGO-Mitarbeiter ab, wie SOS Méditerranée mitteilte. Obwohl sie in internationalen Gewässern stattfand, wurde die Bergungsaktion abgebrochen, und Dutzende Geflüchtete mussten in libysche Lager zurückkehren.
Vergangenen September gab es einen anderen bizarren Vorfall, wie mir Felix Weiss schilderte, Pressesprecher von Sea Watch und an jenem Tag an Bord eines Beobachtungsfluges. Die Libyer griffen innerhalb von Maltas Hoheitsgewässern ein Boot mit Migranten auf, zwangen die Menschen auf ihr Schiff – und fuhren dann mit dem leeren Flüchtlingsboot im Kreis. “Wir dachten: Okay, vielleicht sind sie völlig plemplem und wollen einfach nur Spaß haben. Also flogen wir fort”, sagte Weiss. “Zwei Tage später stießen wir erneut auf das Boot, ein blaues mit arabischer Beschriftung und speziellen Nummern darauf.” Eine neue Gruppe Flüchtlinge war damit unterwegs nach Lampedusa. “Also hat die libysche Küstenwache das Boot zurück nach Libyen geschleppt. Dann bekamen es die Schmuggler in die Hände, um es erneut für diese Migrationsroute zu nutzen”, so Weiss. “Natürlich ist es möglich, dass die Küstenwache das Boot einfach weggeworfen hat und die Schleuser es sich vom Schrottplatz holten. Aber seien wir ehrlich: Für mich ist es offensichtlich, dass Küstenwache und Schleuser recht engen Kontakt pflegen.” Das Fahren im Kreis, so glaubt er, diente vermutlich dazu, die Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. “Finden sie ein Boot, das sich noch verwenden lässt, testen sie es und nehmen es mit zurück nach Libyen.”

§
Zwischen 2012 und 2014 war ich 32 Monate lang Geisel somalischer Piraten, gefangen genommen, als ich in Somalia über Piraterie recherchierte. Ich bin sowohl amerikanischer als auch deutscher Staatsbürger, lebte seit Langem in Berlin. Als ich nach fast tausend Tagen aus der Gefangenschaft nach Deutschland zurückkehrte, setzte gerade die große Wanderung von Flüchtlingen aus Afghanistan und Syrien ein, die die Kanzlerschaft von Angela Merkel prägen sollte.
Ich begriff schnell, dass sich das Geschäftsmodell der Piraten nicht groß von dem der Schleuser unterscheidet. Ein jugendlicher Flüchtling aus Somalia sagte der britischen Tageszeitung The Independent 2016, in einem sudanesischen Internierungslager habe er außer “Keksen und Mangosaft” nichts bekommen. Das kam mir bekannt vor. Auch mir hatte man in meiner Zeit als Geisel genau diesen süßen Mist gegeben. Ich stieß bei weiteren Recherchen auf einen Finanzier somalischer Piraten, die groß ins Schleusergeschäft in Ostafrika eingestiegen waren. Die Gemeinsamkeiten zwischen Piraten und Schmugglern liegen auf der Hand: Beide benötigen Kalaschnikows, Geländewagen, eine billige Versorgung mit Lebensmitteln. Und in beiden Bereichen können organisierte Banden atemberaubende Gewinne erzielen.
Doch was ich an Geschichten über die Lager in Libyen erfahre, ist schlimmer als alles, was ich in Somalia hörte oder selbst erlebte. Geflüchtete müssen Monate oder sogar Jahre dicht gedrängt in Lagerhallen aushalten, ohne Schaumstoffmatratzen oder Decken. Das Recht zu duschen oder Wasser zu bekommen, erkämpft man sich mit den Fäusten. Es gebe viele Geschichten über Migranten, die in Libyen als Sklaven gehalten wurden, berichtet der Autor und Libyen-Experte Jason Pack. Frauen müssen putzen oder sich prostituieren, Männer schuften auf Farmen oder auf dem Bau.
Eine Überfahrt auf einem Seelenverkäufer kostet pro Kopf Hunderte oder sogar Tausende Dollar. Wenn inhaftierte Migranten mit panischer Stimme ihre Familien daheim anrufen, klingen diese Preise wie Forderungen nach Lösegeld, das sie aufbringen müssen, wollen sie ihre Verwandten aus den stinkenden und unmenschlichen Lagern freibekommen.
Gleichzeitig schieben Italien und die Europäische Union Dutzende Millionen Euro der libyschen Küstenwache zu. Ihre Flotte besteht aus zusammengewürfelten italienischen Schiffen, auf denen Männer mit Kalaschnikows fahren, mit besten Beziehungen zu den Milizen, die um die Macht im Land ringen.
Eine normale Behörde ist diese Küstenwache jedenfalls nicht. Die Schiffe, denen wir auf der Humanity 1 begegneten, setzten nicht nur die EU-Politik durch, sondern agierten zugleich auch als der lange Arm der Schmugglerbanden. “Die Küstenwache hat schon immer mit den Italienern zusammen daran gearbeitet, Migranten abzuschrecken”, sagte mir Jason Pack. “Einige nehmen Geld dafür, Migranten zu schmuggeln, und dann nehmen sie noch einmal Geld dafür, sie wieder zurück an Land zu bringen.” Das Schleusergeschäft im Mittelmeer ist wie eine Waschmaschine, die Menschen im Schleudergang so lange herumwirbelt, bis auch der letzte Cent mit ihnen verdient ist.
Viele westliche Journalisten sprechen davon, dass die EU ihre “Drecksarbeit” bei der Migrationskontrolle an die libysche Küstenwache ausgelagert habe. Brüssel bezahlt demnach die Libyer dafür, dass die Migranten es gar nicht erst in die internationalen Gewässer des Mittelmeers schaffen, wo sie als Menschen in Seenot gelten und von Schiffen wie der Humanity 1 aufgenommen werden. So weit, so richtig, aber wer glaubt, es würde weniger geschleust, wenn man die Boote abfängt, macht es sich zu einfach.
Einst hatte Libyens Herrscher Muammar al-Gaddafi diese Arbeit besorgt, der Europas oft rassistische Ängste nutzte, profitable Hilfspakete auszuhandeln, und dafür im Gegenzug die Migranten fernhielt. Bis er im Oktober 2011 im Zuge des Arabischen Frühlings durch einen Aufstand und durch Luftschläge der Nato gestürzt und schließlich von Rebellen getötet wurde. Als Italien und die Europäische Union 2017 massive Hilfspakete für eine entschlossen durchgreifende libysche Küstenwache ankündigten, klang das für die europäische Öffentlichkeit wie eine – wenn auch unvollkommene – Lösung. Die USA, Russland, Türkei, China – wohl kein großes Land der Welt betreibt eine Grenzpolitik, die frei ist von Rassismus, Korruption oder Missachtung für die Bedürfnisse der Machtlosen. Das soll weder den Rassismus noch die Politik entschuldigen. Was sich in Libyen abspielt, gleicht einem der unteren Kreise der Hölle.

§
Kapitän Josh nahm an diesem Nachmittag im April Kurs auf ein drittes Boot. Nach einer Stunde verschwand es vom Radar, also machten wir uns in RHIBs, schnellen Festrumpfschlauchbooten, auf den Weg. Wir jagten hierhin, wir jagten dorthin, aber der Ozean war wie eine blaue Wüste, windig und öde. Keine Spur von einem Boot oder Wrackteilen.
Nach drei Stunden gaben wir auf und hofften auf eine ruhige Nacht, aber gegen 21 Uhr gab der Kapitän bekannt, er habe einen weiteren Notruf erhalten und hoffe, die Geflüchteten in etwa zwei Stunden zu erreichen. Das war nicht gut. Bergungen bei Nacht, bei starker Dünung oder unter “chaotischen Umständen” sind gefährlich.
Zwei Stunden später warteten wir in Rettungswesten und Helmen darauf, dass die RHIBs zu Wasser gelassen wurden. Nach zwanzig Minuten stießen wir auf Geflüchtete, die sich dicht an dicht auf einem Floß drängten, einem kaum zehn Meter langen Gummi-Teppich. Männerstimmen brüllten, es herrschte Chaos. Unsere Boote näherten sich, die Seenotretter warfen Rettungswesten herüber und entfernten sich wieder.
Schon bald trugen alle Personen an Bord des Floßes die klobigen orangefarbenen Westen. Vivianas Team begann, Geflüchtete auf ihr RHIB zu hieven. Die Aufregung ließ etwas nach. Während die ersten 20 Menschen zur Humanity 1 gebracht wurden, blieben wir zurück und hofften, dass niemand ins Wasser fiel.
In unserem Boot war Stefan, genannt “Steffi”, der hauptberuflich Krankenwagen fährt. Ihm gelang es, die Geflüchteten auf Englisch einigermaßen zu beruhigen.
Das erste Boot kehrte zurück und nahm weitere 20 Personen auf, dann näherten wir uns dem Floß. Mir fiel die Aufgabe zu, die Männer im hinteren Teil des Boots zu organisieren und ihnen zu zeigen, wo sie sich festhalten sollten.
“Woher bist du?”, fragte ich.
“Sudan”, sagte ein Mann. “Kennst du den Sudan?”
“Ja.”
“Woher bist du?”, fragte mich einer der Sudanesen.
“Berlin”, erwiderte ich.
69 Personen waren auf dem Floß, davon 68 Männer aus Nigeria, Mali, Niger, Sudan, Eritrea, Ghana, Senegal, Guinea-Bissau und Guinea. Die einzige Frau war eine 19-jährige Nigerianerin. Sie verschwand für einige Tage auf der Frauenstation, wo sich unsere Hebamme Jade um sie kümmerte.
Wir verteilten Decken, Hoodies und Snacks. Wir konnten Duschen anbieten und heißen schwarzen Tee, aber die Männer mussten an Deck schlafen. Die Zustände waren angenehmer als in den libyschen Lagern, aber nicht dramatisch besser.
“Libyen”, sagte ein müder Nigerianer mittleren Alters mit wachen Augen und einem von weißen Haaren durchsetzten Bart, “Libyen ist ein böses Land.” Sein Name war Loki, jedenfalls verstanden die meisten von uns es so.
“Wie lange warst du dort?”, fragte ich.
“Zwei Jahre.”
Loki blickte über das Deck, dann berührte er mich an der Schulter. “Wenn du in Libyen schlafen willst, dann schläfst du mit einem Auge offen”, erklärte er.
“Was haben sie dir zu essen gegeben?”
“Gar nichts.”
“Nichts?”
“Sie schlagen dich”, sagte Lokis Freund Emmanuel. Er zeigte auf einen Schlauch, der zusammengerollt an Deck lag. “Mit so etwas verprügeln sie dich.”
Loki sagte, er sei aus dem Internierungslager Zuwara entkommen, aber es blieb unklar, wie er es auf das Floß geschafft hatte. Emmanuel sagte, er habe 400 libysche Dinar für die Überfahrt bezahlt, das entspricht etwa 75 Euro. Die Preise schwanken von Flüchtling zu Flüchtling, aber der niedrige Preis liefert einen Hinweis darauf, wie groß die Schmuggler die Erfolgsaussichten des Floßes einschätzten.
Ich wandte mich an Loki: “Wie buchstabierst du deinen Namen?”
“L-U-C-K-Y.”
Die junge Frau gab ihren Namen mit “Happiness” an. Als es ihr nach einigen Tagen besser ging, erklärte sie sich bereit, mit einem Journalisten zu sprechen. Wegen einer Zwangsheirat habe sie Nigeria verlassen. Eine Freundin habe ihr Arbeit in Libyen angeboten, also habe sie sich über Land auf den Weg gemacht. “Aber was sie mir nicht gesagt hatte, war, dass ich als Prostituierte arbeiten sollte. Ich sagte, diese Arbeit könne ich nicht machen. Daraufhin erklärte sie, ich müsse zwei Millionen Dinar bezahlen.”
Das sind etwa 380.000 Euro. “Also versuchte ich zu fliehen, dabei lief ich der libyschen Polizei in die Hände.” Die Polizisten hätten sie in ein Internierungslager verfrachtet, sagt Happiness. “Dort belästigten mich die Wärter, und ich wurde schwanger.” Sie glaubt, das Essen im Lager sei mit Schlafmitteln versetzt gewesen, damit die Geflüchteten ruhig bleiben. Die Medikamente seien auch der Grund für ihre Fehlgeburt gewesen. “Als sie sahen, dass es mir nicht gut geht, beschlossen sie, mich freizulassen.”
Eine Zeit lang lebte sie im Armenviertel bei Tripolis. Happiness unternahm einen Versuch, nach Europa zu gelangen, wurde aber von der Küstenwache aufgegriffen. “Die Libyer kamen in einem kleinen Schiff, einem schnellen Boot”, erzählte sie. “Sie riefen, dass sie uns rammen würden und dass wir alle sterben sollten. Also flehten wir sie an.” Die Libyer hätten angeboten, sie nicht zu versenken, sondern zu verhaften. Einige Leute drängten sich auf das Boot der Küstenwache, der Rest wurde in einem Schlauchboot, das an Luft verlor, ans Ufer geschleppt.
Sie landeten in Zuwara, wo die Küstenwache die Geflüchteten der “Polizei” übergab, die, wie Happiness sagte, gemeinsame Sache mit der Küstenwache macht. Die Polizei verlangte 1000 Dinar Bußgeld wegen versuchter illegaler Migration. Happiness nahm bei Geldverleihern einen Kredit auf, um die Strafe begleichen zu können, benötigte aber nun auch Arbeit. Von Libyern wurde sie als Putzfrau vermittelt. Sie arbeitete praktisch umsonst, um ihren Kredit abstottern zu können. “Ich arbeitete, arbeitete, arbeitete, bis ich den Mann bezahlt hatte”, sagte sie.
Was ließe sich anders machen?
Das zweite Rettungsschiff versucht, sich dem Mutterschiff in der Nacht der Rettung zu nähern. © Maria Giulia Trombini
Im April hatte sie genügend Geld für eine weitere Überfahrt beisammen. Die Schleuser steckten sie in eine schäbige Unterkunft am Meer, wo sie mehrere Tage auf günstiges Wetter warten musste. Am 20. April ließen die Schmuggler die Gruppe ein Schlauchboot über den felsigen Strand zum Wasser tragen. Sie gaben den Flüchtenden einen Kompass, ein Satellitentelefon und einige Kanister Treibstoff mit und zeigten ihnen ungefähr, in welche Richtung das circa 150 Seemeilen entfernte Lampedusa liegt.
19 Stunden verbrachten sie im Wasser. Sie schafften etwa 70 Seemeilen, bevor ihnen das Benzin ausging. Nach Sonnenuntergang nahm die Dünung zu. “Als ihr kamt, leckte unser Boot”, sagte Happiness. “Wasser drang ins Boot ein, der Kompass war nass geworden, und das Satellitentelefon hätte bald den Geist aufgegeben.”

Der Anblick von Happiness, Lucky und den anderen Geflüchteten auf hoher See erinnerte mich an das berühmte Gemälde Das Floß der Medusa von Théodore Géricault. 1816 war die französische Fregatte Méduse vor Westafrika auf eine Sandbank gelaufen. Die Offiziere setzten sich in die wenigen Rettungsboote, die unteren Ränge der Besatzung, darunter eine Frau, wurden auf einem zusammengezimmerten Floß ihrem Schicksal überlassen. Die meisten verendeten elendig, es gab Berichte über Kannibalismus. Das Gemälde zeigt die ganze Verzweiflung dieser Menschen. Ich hatte es noch Wochen nach meiner Fahrt mit der Humanity 1 vor Augen. Natürlich war dieser Schiffbruch schrecklicher als das, was am 20. April vor Zuwara passierte.
Worum es mir geht: Ereignisse wie an diesem Tag tragen sich – ungemeldet und unbeachtet – Tag für Tag im Mittelmeer zu. Europa ist es nicht gelungen, seine Immigrationsrouten unter Kontrolle zu bringen. Zu glauben, man müsse der libyschen “Küstenwache” bloß Millionen Euro in den Schoß werfen und die Schleuserwege würden austrocknen, ist entweder naiv oder zynisch.
Nach fünf Tagen erreichten wir Ravenna. Um den Zustrom an Migranten zu bremsen, hat Italien Rettungsschiffen neue Restriktionen auferlegt – wir hatten uns in der Nähe von Sizilien befunden, Ravenna liegt unweit von Venedig. Diese Politik geht auf die neue ultrarechte Regierung unter Georgia Meloni zurück. Die wurde nicht zuletzt deswegen ins Amt gewählt, weil so viele Italiener sich von Europas Migrationspolitik im Stich gelassen fühlen.
Was aber ließe sich anders machen? Das Mittelmeer erinnert heute an den Golf von Thailand Ende der 1970er-Jahre, als rund 1,6 Millionen “Boat-People” aus Vietnam flohen, weil die dortige kommunistische Regierung nach Kriegsende ihre Gegner in Arbeitslager steckte. Die US-Präsidenten Ford und Carter legten ein massives Umsiedlungsprogramm für die Region auf. Menschen aus Südostasien konnten nun aus dem Ausland Asyl beantragen und mussten sich nicht Menschenschmugglern ausliefern. Heute gibt es in den USA vietnamesische Gemeinden in Kansas, kambodschanische im südlichen Kalifornien, Laoten in Texas.
Präsident Biden will nun in Lateinamerika Migrationszentren einrichten, in denen sich die Menschen direkt bei amerikanischen Beamten über die Möglichkeiten, Asyl zu beantragen, informieren können, anstatt auf Lügen, Gerüchte und Versprechen hereinzufallen. Viele Menschen, die aus dem Mittelmeer geborgen werden, hätten keine Ahnung, wie gut oder schlecht ihre Aussicht auf Asyl überhaupt sei, sagt Till Rummenhohl, Geschäftsführer von SOS Humanity: Knapp über die Hälfte aller aus dem Mittelmeer Geborgenen würden abgelehnt und müssten eigentlich zurück in ihre Heimatländer. “Bekommt man im eigenen Land zu hören, dass die Chancen aktuell minimal sind, überlegt man es sich vielleicht zweimal, bevor man in ein Boot steigt.”
Als wir in Ravenna anlegten, war es kühl und grau. Die Geflüchteten trugen Wollmützen und Hoodies wegen der für sie ungewohnten Kälte des norditalienischen Frühlings. Der Pier war voll mit Polizei, einem Krankenwagen, dem Roten Kreuz, der Guardia Costiera, Vertretern der Medien und der Einwanderungsbehörde. Der Abschied fiel emotional aus. Wir beobachteten, wie die Geflüchteten mit ihren Ängsten und oft unrealistischen Hoffnungen zu ihrer medizinischen Untersuchung geführt wurden. Bei Happiness stünden die Chancen auf Asyl wohl gut, sagte die Schiffshebamme, weil sie vor einer Zwangsheirat geflohen und auf der Flucht auch noch vergewaltigt worden war. Und die anderen?
Unterdessen haben sich Dutzende weitere rostige Kähne und lecke Schlauchboote, überladen mit Flüchtlingen, auf den Weg gemacht. Vor wenigen Tagen kam es auf der Mittelmeerroute zu einer der größten Katastrophen, als ein maroder Kutter, überladen mit bis zu 700 Migranten, vor den Augen der griechischen Küstenwache kenterte. 104 Überlebende wurden gemeldet, und Europa ist wieder für einen Moment aufgeschreckt. Wie viele Flüchtlinge unterdessen von der libyschen Küstenwache abgefangen wurden, ist nicht bekannt. Klar ist, dass die Menschenschmuggler in Libyen weiter gut verdienen.
§
Der Autor und Journalist Michael Scott Moore hat mehrfach Seenotrettungen begleitet. In diesem Text beschreibt er eine nächtliche Rettungsaktion auf einem deutschen Schiff im April dieses Jahres und schildert dabei eindrucksvoll die Hintergründe im tödlichen Geschäft der Schlepper. Weitgehend unbekannt ist, wie die EU den Schmuggel unwillentlich mitfinanziert: indem sie und vor allem das Mitgliedsland Italien der libyschen Küstenwache zur “Migrationsabwehr” Geld, Schiffe und andere Ausrüstung zur Verfügung stellt. Moore begleitete die Crew der Nichtregierungsorganisation SOS Humanity, die mit ihrem Schiff in Seenot geratene Flüchtlinge auf dem Mittelmeer zu retten versucht – und dabei immer wieder deutliche Hinweise findet, dass die libysche Küstenwache und Schmugglerbanden kooperieren.
Moore befasst sich seit Jahren mit organisierter Kriminalität. 2012 geriet er bei Recherchen zu Piraterie für über zweieinhalb Jahre in Geiselhaft somalischer Piraten, in seinem Buch “Wir werden dich töten” berichtet er über seine Erfahrungen. Heute sieht er erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen den Geschäftsmodellen von Piraten und Menschenschmugglern, wie sie vermutlich auch im Fall der 700 verunglückten Migranten südwestlich der Halbinsel Peloponnes beteiligt waren. Mehrere aus Ägypten stammende Überlebende des Unglücks wurden als mutmaßliche Schlepper und Organisatoren der Fahrt verhaftet.

Rafts of the Medusa
Why every day on the Mediterranean is a new scandal for Europe. For both Foreign Policy and Die Zeit.
California’s Attempt at Land Reparations
How land seized from a Black family 100 years ago may be returned. The Bruce’s Beach story from a hometown angle, for The New Yorker
Day of the Oprichnik, 16 Years Later
The novelist Sorokin, the president Putin, his man Dugin, and the war in Ukraine. For n + 1.

There Must Be Some Way Out of Here
An essay on Bob Dylan, “All Along the Watchtower,” and Somali pirate captivity.
My Century, by Günter Grass
A pastiche-novel in 100 chapters, rooted in the political surges of Germany’s horrid and fascinating 20th century.
Denis Johnson, Poet of the Fallen World
“I’m kinda like Ozzy Osbourne,” says Denis Johnson in a distracted moment, explaining that he might not remember to call me back. “My wife was just telling me that.”

Cambodian Seafarers Talk About Pirates
Mike visits Cambodia for The New Yorker to talk about a harrowing shared experience in Somalia
The Muslim Burial
Cambodian hostages remember digging a grave for one of their own. A sequel chapter to The Desert and the Sea
The Real Pirates of the Caribbean
Adventure journalism in Southern California. A travel essay for The Paris Review.

Antifa Dust
An essay on anti-fascism in Europe and the U.S., for the Los Angeles Review of Books
Was Hitler a Man of the Left?
A book that helped Republicans in America lose their damn minds.
Ghosts of Dresden
The Allied firebombing of Dresden in 1945 destroyed the baroque center of what Pfc. Kurt Vonnegut called, in a letter home from Germany, “possibly the world’s most beautiful city.”

George Freeth, Biographed
The first academic treatment of America’s surf pioneer. Also, was Freeth gay?
It’s Called Soccer
Americans live on what amounts to an enormous island, defended on two shores by the sea, and we’ve evolved a few marsupial traditions that nobody else understands.
Tilting at Turbines (in the Severn River)
The morning was clear and cold, with frost on the church steeple and the cemetery grass. I had a quick English breakfast at a white-cloth table, in my wetsuit, and drove to Newnham, a village on the Severn River in Gloucestershire, parking near the White Hart Inn.

The Curse of El Rojo
I’d packed the car lightly — a bag of clothes, a bag of cassette tapes, a backpack of books, a few essential tools.